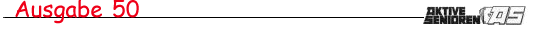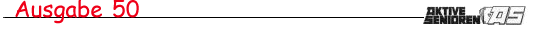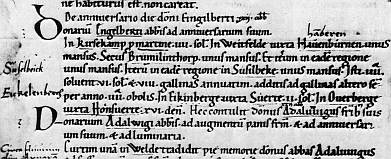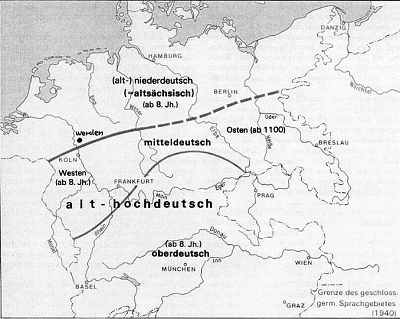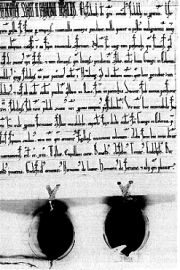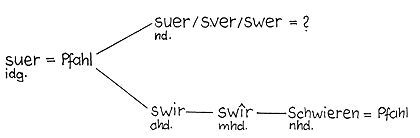Vom Namen und dem Wappen
der Stadt Schwerte
Teil I: Zur Namensdeutung von Schwerte
Die älteste schriftliche Überlieferung des Namens "Schwerte" lautet
"suerte". Wir finden ihn in dieser Form im "Werdener Urbar", einem
Schenkungsverzeichnis der Reichsabtei Werden a. d. Ruhr von etwa 970 und
1100, in einer Abschrift des 12. Jhdts.
In der Frage zur Bedeutung des Namens suerte gehen freilich die Meinungen
der Fachleute weit auseinander. So interpretiert Dr. Wilhelm Bleicher den
Namen, indem er von einem dreisilbigen su-er-ta ausgeht, als "Ort, wo es
Schweine gibt"(1) Prof. Dr. Paul Derks dagegen als "Die Schwärze"(2).
Die bisherige Deutung von suerte, als "nasse Erde", ist dagegen ins
Hintertreffen geraten. Wer hat nun Recht? Hierüber ist es zwischen
Derks und Bleicher zum Gelehrtenstreit gekommen, der von Derks, mit heftigen
Angriffen gegen Bleicher, in die Öffentlichkeit getragen wurde.
Auszug aus dem Werdener Urbar von etwa 970, in der Abschrift
des 12.
Jhdts. StADüsseldorf, Werd. Dep. + HS Nr. 9, Bl. 31b.
Obwohl ich kein Sprachwissenschaftler sondern nur ein Laie bin, sind mir
doch die Schwächen der Bleicher'schen Thesen wohl bewusst. Sie
bedürfen gewiss teilweise noch der Nachbesserung, keinesfalls der
Damnatio. Doch auch die umfangreiche Arbeit von Derks lässt etliche
Fragen unbeantwortet, bzw. hat er sie sich erst gar nicht gestellt. Der
Grund liegt meiner Meinung nach in dem Ausschließlichkeitsanspruch
seiner Thesen. So lässt er nur eine altsächsische-niederdeutsche
Herkunft des Namens suerte gelten. Auf dieser Basis vertritt er seine Thesen
mit sprachwissenschaftlichen Methoden logisch, schlüssig, konsequent.
Doch so überzeugend seine Beweisführung auch ist, sie gilt nur,
wenn auch die Ausgangslage stimmt. Doch daran hege ich erhebliche Zweifel.
Daher lege ich im Folgenden auch den Finger an die Stellen, wo es schmerzt.
Um es gleich vorweg zu sagen, mit Schwertern hat der Name unserer Stadt
nichts zu tun, da nach dem hier im Hochmittelalter gesprochenen
altsächsich-niederdeutschen Dialekt das Wort Schwert, als "swerd", mit
auslautendem "d" gesprochen und geschrieben wurde und die althochdeutsche
bzw. mittelhochdeutsche Sprachgrenze zum Niederdeutschen um 1000 herum
unseren Raum nicht berührte. Daher kann das althochdeutsche "swert"
mit auslautendem "t" auch nichts mit "suerte" zu tun haben.
Gegen diese, von Gerhard Hallen, Dr. Leopold Schütte3) und Paul
Derks4) vertretene Ansicht ließen sich allerdings zwei gewichtige
Gegenargumente ins Feld führen. Zum Einen entstand das Werdener Urbar
unmittelbar an der althochdeutschen-altsächsischen Sprachgrenze, wie
Sie der Karte entnehmen können. Ein althochdeutscher Spracheinfluss auf
den Schreiber des Urbars kann darum nicht generell ausgeschlossen werden.
Zum anderen sind da noch die nach 1200 auftretenden Schreibweisen "sverthe"
und "Swerthe" etc. Nach Derks entspricht das darin enthaltene "th" im
Altsächsischen, im Mittelniederdeutschen und Hochdeutschen dem Laut
"d". Die Namen wären somit als "sverde/swerde" zu lesen.
Karte der geographischen Sprachgrenzen nach: Werner König, dtv-Atlas
zur deutschen Sprache, 1978, grob vereinf. Darstellung.
Wenn wir den Derks'schen Thesen weiter folgen, so müssen wir bereits
das "u" in suerte, und somit auch das "v" in "sverte/sverthe" als "w"
lesen. Sollte dies zutreffen, so könnte der Name Swerte/Swerde sowohl
im Altsächsischen als auch im Althochdeutschen auf das Schwert als
Waffe zurückgeführt werden. Doch ist das sehr unsicher. Daher
lasse ich es bei dieser Aussage und versuche das Problem anders anzugehen.
Um die Verwirrung vollständig zu machen, will ich daher
zusätzlich noch eine weitere Deutungsvariante vorstellen. Mögen
meine Thesen und Schlussfolgerungen nun richtig oder falsch sein, so
wären sie im letzten Falle trotzdem nicht vergebens, würden sie
doch mit dazu beitragen, das Unmögliche auszuschließen.
Ausgangspunkt der Forschung muss die älteste Namensform von
"Schwerte", das orthographisch dreisilbige "su-er-te" sein, wie wir es im
Werdener Urbar finden. Größte Unklarheit besteht hinsichtlich der
Lesart von "suerte". Da in dem Urbar der Schreiber einerseits den Vokal
"u" für sich selbst, andererseits aber auch für den Halbvokal
"v" setzt, können wir "suerte" auch als zweisilbiges "sver-te""
lesen, wie es 1150 erstmals urkundlich erscheint und auf dem alle weiteren
Schreibweisen des Namens basieren.
Gegen die von Derks vertretene Ansicht, das "u" in suerte sei als "w"
zu lesen, widerspricht das Urbar selbst. So finden wir nur eine Zeile unter
dem Orts/Gebietsnamen suerte den Eigennamen Adalwigus. Hier ist das "w" als
"Doppel-u" geschrieben, und später (um 1200 ?) mit einem darüber
gesetzten "w" als solches kenntlich gemacht. In der darauffolgenden Zeile
erscheint der Name als "Adalwigi" mit dem "w". Dagegen wird das "u" in
suerte nicht durch ein darüber geschriebenes "w", sondern durch ein
"v" gekennzeichnet. Von der Schreibweise her steht hierbei das Graphem "v"
eindeutig für das gemeingermanische Phonem "f"5). Zumindest im Falle
des Werdener Urbars trifft die sonst wohl mögliche Lesart "u=w" bei
suerte nicht zu! Die Derks'sche These steht hier auf sehr schwachen
Füßen.
Die Kardinalfrage muss daher lauten: Kann sich das orthographische
"suerte" binnen 50 Jahren phonetisch zu"sverte" entwickelt haben?
Ich möchte dies kategorisch verneinen! Innerhalb einer solch kurzen
Zeitspanne ist das nicht möglich. Wir müssen daher m.E. "suerte"
als zweisilbiges "sverte" lesen!
Unstreitig bleibt jedoch, dass wir das dreisilbige "su-er-te"
orthographisch und phonetisch als Stammform ansehen müssen, dessen
Entwicklungsbeginn zur zweisilbigen Namensform "sver-te", vermutlich
Jahrhunderte vor 970 anzusetzen ist.
Wie kann dieser Prozess abgelaufen sein?
Antwort: Da das "s" in "suerte" nicht als stimmhaftes "s", wie in
"sauer, Suhle, etc.", sondern als stimmloses gemeingermanisches
"=ß" gelesen und gesprochen werden muss6), löste es eine
Silbenverschmelzung von "su" und "er" aus, die durch eine
zwangsläufige phonetische Abschwächung des "u" bewirkt wurde.
Aus "su-er-te" wurde so "uër-te", wobei nach einer späteren
Schreibweise zu urteilen, das "e" als kurzer Vokal "ë", wie in
"Emmenthaler, essen, Erde" etc. gesprochen wurde. In letzter Konsequenz
verdrängte schließlich das "v" auch lautlich das
abgeschwächte "u". Schreibweise "sverte"; Lesart nun "vër-te".
Obwohl sich diese Schreibweise, auch in der Nebenform "sverthe" mit
"th=d" (?) noch bis 1279 hält, wird doch ab 1200 das "v" durch das
lautlich nähere "w" zunehmend verdrängt, wobei die Form "swerte"
von 1346 bis 1595 absolut dominiert.
Name
Schreibweise | 10. Jhdt. | 11. Jhdt. | 12. Jhdt. | 13. Jhdt. | 14. Jhdt. | 15. Jhdt. | 16. Jhdt. |
| Suert | ca. 970 | ca. 1083/99 | | | | | |
| Sverte | | | 1150 | 1200
1231
1236
1243
1254
1279 | | | |
| Swirte | | | | 1213
1255
1293 | 1324 | 1473 | |
| Swirthe | | | | 1222 | | | |
| Svirthe | | | | 1222
1249 | | | |
| Swerthene | | | | 1225 | 1343 | | |
| Sverthe | | | | 1226
1246 | | | |
| Swerthe | | | | 1232
1245
1246 | | | |
| Swerte | | | | 1243 | 1346
1352
1362
1389
1390
1391
1396
1397 |
1401
1421
1424
1426
1428
1429
1431
1435
1436
1452
1463
1467
1468
1480
1493
|
1507
1518
1520
1523
1531
1560
1596
|
| Sweirte | | | | | 1351 | 1401
1409
1420 | |
| Sweyrte | | | | | 1374
1399 |
1418
1437
| |
| Swierte | | | | | 1381
1396
1397 |
1406
|
1581
|
| Suerten | | | | | | 1491 | |
| Sweirten | | | | | | | 1534 |
| Schweirte | | | | | | | 1562 |
| Schwierthe | | | | | | | 1567 |
| Schwerdte | | | | | | | 1578
1582
1592 |
| Schwert | | | | | | | 1590 |
| Schwerte | | | | | | | 1592
1598
bis heute |
Tabellarische Auflistung der Schreibweisen des Namens Schwerte.
Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Doch um 1200 geschieht etwas Erstaunliches. Neben den Schreibweisen
"sverte" und "swerte" erscheint völlig unvermittelt die Form
"swirte", die sich erstmals für 1213 belegen lässt7). Mit den
Varianten "svirthe-swirthe-Swierte", bis hin zu "Schwierthe", bildet diese
Form eine eigene Gruppe, die sich parallel und zeitgleich zur swerte-Gruppe
stellt, wie meine Zeitebenendarstellung des Namensspektrums Schwerte vor
Augen führt. Dieser Vokalwechsel vom "e" zum "i" geschieht so
schlagartig und sporadisch, dass man ihn nicht mit einer Lautverschiebung
erklären kann. Nein, es kann sich meiner Meinung nach nur um den
Einbruch eines anderen Dialektes in die hiesige Niederdeutsche
Schriftsprache handeln, der aus dem Rheinisch-Kölnischen zu uns gelangt
sein muss und stark vom Althochdeutschen bzw. Mittelhochdeutschen
geprägt sein dürfte.
Diese "Swirte-Gruppe" lässt Derks, mir absolut unverständlich,
völlig unberücksichtigt. Frage: Warum?
|
|
|
Die Urkunde von 1213, mit der erst-
maligen Nennung von "swirte".
|
Es steht aber wohl außer Frage, dass "swerte" und "swirte"
inhaltlich denselben Begriff umschreiben, dessen Bedeutung uns noch
unbekannt ist. Will man jedoch seine Bedeutung erschließen, so
dürfen wir uns ihm nicht nur über die
altsächsisch-niederdeutsche Sprache her nähern, wie Derks es tut,
sondern müssen sehr wohl auch das Althochdeutsche mit in Betracht
ziehen und nach gemeinsamer Wurzel suchen.
Wie Dr. Bleicher schon in seiner Arbeit8) ausführte, lässt sich
z.B. das althochdeutsche "swiron = bepfählen" auf dessen vorerst
hypothetisches Substantiv "Swir = Pfahl" zurückführen, das wir
auch im mittelhochdeutschen "Swîr = Uferpfahl", im angelsächsischen
"Swier = Pfosten und im Neuhochdeutschen (schweiz.) "Schwieren = Pfahl"
wiederfinden.
"Swirte" könnte demnach als "Ort der Pfahlsetzung" interpretiert
werden, was immer es auch bedeuten mag.
Nun lässt sich aber mit einiger Wahrscheinlichkeit
"Swir/Swîr/Swier", bei gleichem Sinninhalt, auf das indogermanische "suer"
= Pfahl, Doppelpfosten oder langes Holzstück zurückführen9),
das möglicherweise schon als einsilbiges "uer" gesprochen wurde.
Liegt es da nicht nahe, auch die Wurzel von "suerte" im Indogermanischen zu
vermuten? Dies würde aber bedeuten, dass sich im Namen "suerte"
uraltes, vielleicht keltisches oder vorgermanisches Namensgut erhalten hat,
wie es auch bei den Flussnamen Ruhr, Röhr und Möhne vermutet wird.
Diese Variante hat schon Wilhelm Bleicher in seinem Aufsatz angedacht,
aber leider nicht weiter verfolgt.

Vermutliches Entwicklungsschema von suerte zu swerte.
Eine mögliche keltische Herkunft des Namens Schwerte lehnt Derks
kategorisch ab: "Von den Kelten im altwestfälischen Raum hat die
Forschung indes lange Abschied genommen"10), und: "...weiß Bleicher
doch selbst, dass die Gallier oder andere Kelten nicht in Westfalen
gesiedelt haben."11)
Dem ist entgegenzuhalten, dass die Kelten als Träger der
Latènekultur zweifelsfrei feststehen und diese Kultur, in der
vorrömischen Eisenzeit, durch Siedlungsreste, Gräberfelder und
zahllose Einzelfunde in Westfalen nachgewiesen ist12).
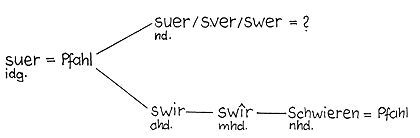
Vermutliche Ableitung des niederdeutschen Swerte und mittelhochdeutschen
Swirte vom sinngleichen indogermanischen suer=Pfahl.
Wir müssen also in Westfalen in der vorrömischen Eisenzeit von
einer zumindest kelto-germanischen Mischbevölkerung ausgehen, die von
der keltischen Latènekultur geprägt war. Bei der keltischen
Kulturdominanz in Westfalen einen keltischen Spracheinfluss auf die
Bevölkerung völlig auszuschließen, ist wohl mehr als
unwahrscheinlich. Wenn auch, nach dem bisherigen Erkenntnisstand, in
Westfalen keine keltischen Ortsnamen überliefert sind, so kann man
daraus m.E. allenfalls auf einen plötzlichen Zusammenbruch dieser
Kultur, und eine nachfolgende Germanisierung schließen, in deren Folge
größtenteils eine Neubenennung erfolgte.
Kommen wir nun zur These von Prof. Derks, der "suerte" vom
altsächsischen-niederdeutschen "suart/swart"13) ableitet, das im
Althochdeutschen übrigens "swarz" lautet. Natürlich lässt
sich von "suart", das wie im Falle "Suerte" mit stimmlosem "s" und
abgeschwächtem "u" gesprochen wird, der Begriff "uërte/ wërte" =
die Schwärze ableiten, das als Adjektivabstraktum im Niederdeutschen
übrigens nicht nachzuweisen ist. Doch was beweist das schon?
Zeitebenendarstellung der Schreibweisen des Namens Schwerte. Links: Die verm. niederdeutsche Swerte-Gruppe. Davon abzweigend die Regional-Plattdeutsche Sweirte-Gruppe. Dessen letzte Form "Schwäierte" (19.Jhdt.) ist hier nicht erfasst.
Es ist ein Faktum, dass Menschen aller Zeiten einem geographischen Punkt
oder Gebiet Namen beilegten, durch den er oder es definiert wurde. D.h. ich
kann begreifen, dass man evtl. den Raum Schwerte als den "Schwarzen Ort"
oder das "Schwarze Gebiet" charakterisiert hat, was immer auch der Anlass
dazu gewesen sein mag (Beisp.: schwarte Bierke/schwarzer Bach i. Holzw.
Flurn. Am Schwarzenbach). Nicht begreifen kann ich jedoch, dass man ihn als
definitionslose abstrakte "Schwärze" bezeichnet haben soll. Auch Derks
vermag hierfür nicht ein Parallelbeispiel beizubringen.
So reduziert sich meines Erachtens auch die Derks'sche Fleißarbeit
auf bloße Theorie. Sie ist und bleibt vorerst nur eine These, deren
Wahrheitsgehalt sich erst noch erweisen muss.
Reinhold Stirnberg
Anmerkungen:
- W. Bleicher, Das älteste Schwerte - Gedanken zur Deutung des
Ortsnamen. Hohenlimburger Heimatblätter, Heft 4/98.
- Paul Derks, Der Siedlungsname Schwerte, in: Beiträge zur Geschichte
Dortmunds u. d. Grafschaft Mark, Bd. 90, Dortmund 1999, S. 8ff.
- Westf. Städteatlas, Liefer. III, Nr. 9, 1990.
- P. Derks, der Siedlungsname Schwerte... siehe oben.
- Vergl. Braune/Mitzka, Althochdeutsche Grammatik, 12. Aufl. M. Niemeyer
Verl. Tübingen 1967, S. 124 § 137, S. 126 § 139.
- Vergl. Braune/Mitzka s.o., S. 167 § 168.
- Urkunde von 1213. StAKöln, Bestand St. Georg, Nr. 10.
- W. Bleicher, Das älteste Schwerte... S. 129.
- W. Bleicher, nach J. Pokorny: Indogerm.-etym. Wörterbuch, Bd. 1,
Bern/München 1959, S. 1050, Nr. 3.
- P. Derks, Der Ortsname Dortmund, in: Beitr. z. Gesch. Dortmunds u. d.
Grafschaft Mark, Bd. 78/1987, S. 176.
Er zitiert dazu:
Much, Waren die Germanen des Caesar und Tacitus Kelten?
Kuhn, Vor- und frühgerm. Ortsnamen.
Kuhn, Völker zwischen Germanen und Kelten.
Kuhn, Die Nordgrenze der keltischen Ortsnamen.
- P. Derks, Der Siedlungsname Schwerte... s.o., S. 28. Derks bezieht sich
hier auf Bleicher, Älteste Siedlungsräume im nördlichen Sauerland,
in: Der Märker, Heimatblatt f. d. Bereich d. ehem. Grafschaft Mark, 16
(1967), S. 103/104.
- Eine, allerdings unvollständige Übersicht über 17 Fundkomplexe
im Reg.-Bez. Arnsberg in: Die Fundmünzen d. Röm. Zeit in
Deutschland, Abt. VI NRW, Bd. 5 Arnsberg, Gebr. Mann Verlag/Berlin 1972.
- P. Derks, Der Siedlungsname Schwerte... s.o.